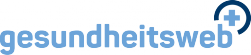Berlin (dpa)- Drohanrufe gibt es nicht mehr und auch der Polizeischutz für den Bonner Wissenschaftler Oliver Brüstle gehört lange der Vergangenheit an. Vor 15 Jahren, am 19. Dezember 2002, erhielt der Mediziner die erste deutsche Genehmigung für die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen.
Für entschiedene Gegner klang das wie ein Freibrief für Frankenstein-Forschung. Für begeisterte Befürworter rückte mit der Stammzellforschung die Hoffnung auf eine schnelle Heilung von Krankheiten wie Parkinson in greifbare Nähe. Heute ist Pionier Brüstle 55 Jahre alt. Was ist vom Hype geblieben – und wo steht Deutschland mit seinem strengen Stammzellgesetz in der internationalen Forschung?
Oliver Brüstle hat keine schnellen Wunder erwartet, schon damals nicht, kurz vor Weihnachten 2002. Der Neuropathologe suchte neue Wege, um zugrunde gegangene Zellen im Nervensystem zu ersetzen – durch im Labor aus embryonalen Stammzellen erzeugte Gehirnzellen. Embryonale Stammzellen werden aus wenige Tage alten Embryonen gewonnen, die etwa bei künstlichen Befruchtungen übrig bleiben. Die aus wenigen Zellen bestehenden Embryonen werden dabei zerstört.
In 15 Jahren hat die Gewinnung von Ersatzzellen aus menschlichen Stammzellen eine rasante Entwicklung erlebt. Brüstle und seine internationalen Kollegen können heute mit großer Präzision verschiedenste Gehirnzellen – und andere Körperzellen auch – aus Stammzellen herstellen. Am Tierexperiment lassen sie sich bereits erfolgreich einsetzen.
132 Genehmigungen zur Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen haben Wissenschaftler in Deutschland seit 2002 erhalten. In einem aufwendigen Verfahren werden die Anträge zunächst von einer Kommission aus Naturwissenschaftlern, Medizinern und Ethikern geprüft, anschließend noch einmal vom Robert Koch-Institut (RKI) für die endgültige Genehmigung. «Da kommt keiner, der sich kurzfristig überlegt hat, dass er jetzt auch mal embryonale Stammzellen braucht», resümiert Zellbiologe Peter Löser, der die Anträge beim RKI prüft. «Das ist alles wohlüberlegt.»
Pionier Oliver Brüstle ist bei seiner Stammzell-Forschung einer Übertragung auf den Menschen inzwischen näher gerückt. Doch er warnt vor Euphorie. «Noch sind Schwierigkeiten zu überwinden.»
Bereits 2006 hat die Forschung einen weiteren Weg für die Stammzell-Gewinnung gefunden. Der Japaner Shinya Yamanaka entwickelte eine revolutionäre Technologie, bei der Stammzellen zum Beispiel aus Haut- und Blutzellen von Patienten rückprogrammiert weren. Es entstehen so genannte induziert pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen), die embryonalen Stammzellen (ES) sehr ähnlich sind. Der große Vorteil: Es werden dabei keine Embryonen benötigt. Bereits 2012 gab es für diese Entdeckung den Medizin-Nobelpreis.
Für die meisten Studien nutzt Brüstle nun nicht allein ES-, sondern auch iPS-Zellen. Mittlerweile setzt sein Labor sogar einen dritten Weg ein: die direkte Umwandlung von Blutzellen in Gehirnzellen ohne den Umweg über iPS-Zellen. «Es gibt nicht die eine ideale Stammzelle. ES-Zellen, iPS-Zellen und die direkte Zellumwandlung werden je nach Erfordernissen parallel für verschiedene biomedizinische Zwecke eingesetzt werden», prognostiziert er. Auch in Deutschland?
Hier wird Brüstle vorsichtiger. «Die restriktive Gesetzeslage hat dazu geführt, dass hierzulande vergleichsweise wenige Wissenschaftler an einem therapeutischen Einsatz von ES-Zellen arbeiten.» Und da viele Methoden von ES- auf iPS-Zellen übertragbar seien, hätten deutsche Teams im Vergleich zu Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Schweden auch einen schwereren Start in die therapeutisch ausgerichtete iPS-Zell-Forschung. Obwohl es viel leichter ist, dafür Genehmigungen zu bekommen. «Heute kooperieren wir mit internationalen Teams in europäischen Verbünden, aber die ersten klinischen Studien werden nicht in Deutschland stattfinden», berichtet Brüstle.
An Patienten in den USA, Großbritannien und Japan werden bereits Studien zur Behandlung einer altersbedingten Augenerkrankung (Makuladegeneration) mit ES- und iPS-Zellen durchgeführt. Auch bei der Parkinson-Krankheit sei der Ersatz von Nervenzellen durch Stammzellen bereits bis zum Experiment an Primaten durchexerziert worden, sagt Brüstle. In den USA, Japan, Großbritannien und Schweden stehe das Verfahren nun kurz vor der ersten Erprobung an Patienten. Deutsche Wissenschaftler hätten wichtige Grundlagen beigesteuert. Doch nun würden sie in die zweite Reihe gedrängt.
Peter Löser sieht eine der Hauptursachen hierfür im deutschen Stammzellgesetz. Denn embryonale Stammzellen dürfen einzig für Forschungszwecke verwendet werden. Eine Nutzung der Zellen, beispielsweise für die Erzeugung von Zellprodukten für die Therapie schwerer Erkrankungen, ist in Deutschland derzeit nicht erlaubt.
Methoden zur Gewinnung von Stammzellen – die wichtigsten Fragen:
Was sind pluripotente Stammzellen?
Eine pluripotente Stammzelle ist eine Art Ursprungszelle, die sich unbegrenzt vermehren und alle Zelltypen des Körpers bilden kann, zum Beispiel Muskelzellen, Nervenzellen oder Blutzellen. Diese Fähigkeit der Stammzellen bezeichnet man als Pluripotenz.
Wie entstehen embryonale Stammzellen?
Embryonale Stammzellen (ES) werden aus dem Inneren von wenige Tage alten Embryonen, also nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, entnommen. Dieser Zellverband heißt Blastozyste. Embryonale Stammzellen können zum Beispiel aus einer Blastozyste entnommen werden, die im Reagenzglas bei einer künstlichen Befruchtung gewonnen wurde, aber nicht mehr für eine Schwangerschaft benötigt wird. Der wenige Tage alte Embryo wird allerdings bei der Gewinnung der Stammzellen zerstört. ES haben den Vorteil, dass sie sich in jede beliebige Köperzelle entwickeln können – mit unbegrenzter Vermehrungsfähigkeit. Es gibt unter anderem die Hoffnung, damit gezielt defekte Zellen im Körper ersetzen zu können.
Was sind induzierte pluripotente Stammzellen?
Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) ähneln den Zellen eines wenige Tage alten Embryos, doch sie entstehen völlig anders. Für ihre Gewinnung werden spezialisierte Zellen wie zum Beispiel Hautzellen im Labor in einen quasi embryonalen Ursprungszustand rückprogrammiert. Der Vorteil ist, dass dafür keine Embryonen zerstört werden müssen. Der Nachteil ist, dass «erwachsene» Zellen sich im Laufe der Zeit verändert haben können, also beispielsweise Mutationen ansammeln. Das lässt sich beim Rückprogrammieren nicht aufheben.
Große Hoffnung machen iPS in der personalisieren Medizin – wenn also Menschen bei einer Stammzell-Therapie mit körpereigenen rückprogrammierten Zellen behandelt werden könnten. Das würde ihnen Medikamente ersparen, die das eigene Immunsystem unterdrücken und damit die Abstoßung der transplantierten Zellen verhindern. Ob das Verfahren praktikabel ist, ist aber noch nicht klar. Mutationen könnten dieses Konzept erschweren – und die Technik zu ihrer Gewinnung ist vielleicht zu kostspielig, um sie jedes Mal neu und individuell für Patienten finanzieren zu können.
Fotocredits: Oliver Berg
(dpa)