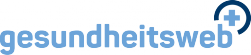Bonn – Jennifer Bauer ist alleine im Ausland unterwegs, als sie plötzlich Zahnschmerzen bekommt. Sie ist hilflos. Ihre Gedanken rasen, die Angst um ihre Gesundheit wird übermächtig: «Ich war irgendwann überzeugt, mein Zahn wird ausfallen.»
Sie sei immer schon ängstlich gewesen, sagt die 31-Jährige heute. Dieses Erlebnis sieht sie jedoch rückblickend als Beginn ihrer Erkrankung. Die generalisierte Angststörung gehört neben den Phobien zu den häufigsten Angsterkrankungen. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung haben einmal in ihrem Leben generalisierte Ängste. «Betroffene sorgen sich meist um Verwandte oder nahestehende Personen.
Sie haben Angst, diesen könnte etwas zustoßen, zum Beispiel ein Autounfall. Die statistische Häufigkeit solcher Ereignisse wird dabei stark überschätzt», erklärt Prof. Borwin Bandelow, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen.
Aber auch Angst um die eigene Gesundheit kann Teil der sogenannten Sorgenkreisläufe sein. In einen solchen hineingesteigert, erleben die Betroffenen auch körperliche Symptome wie Schwitzen, Zittern oder Herzrasen. «Um das 30. Lebensjahr werden die Verantwortlichkeiten umfassender – Heirat, Kinder, Beruf. Vor allem verantwortungsbewusste Menschen mit Selbstzweifeln glauben dann, sie könnten diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden und reagieren mit Sorgen und Ängsten», erklärt Prof. Wolfgang Maier, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn.
Ängste oder Sorgen sind bis zu einem bestimmten Maß normal. Wenn diese jedoch den Alltag beeinflussen, dann seien sie krankhaft, sagt Bandelow. Das belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen: «Betroffene greifen häufiger zum Telefon, um sicher zu gehen, dass es ihren Angehörigen gut geht. Viele fühlen sich dadurch kotrolliert oder sind genervt», sagt Prof. Katja Beesdo-Baum von der Technischen Universität Dresden.
Das aktive Durchplanen des Alltags ist für viele Betroffene ein wirksames, wenn auch erschöpfendes Mittel gegen die Sorgen. Denn: Wer keine Pause hat, hat auch keine Zeit zum Grübeln. «Es gibt sogar solche, die sich innerlich Gedichte aufsagen, um an nichts anderes denken zu können», erklärt Beesdo-Baum. Auch für Jennifer Bauer ist es beunruhigend mal nichts vorzuhaben. In ihrer Freizeit telefoniert sie daher häufig. Als sie vor drei Jahren ihren Job verliert, ist sie ihren Ängsten den ganzen Tag ausgeliefert. Kurze Zeit später begibt sie sich in stationäre Behandlung. «Die Zeit zwischen Jobverlust und Klinikaufenthalt war die schlimmste meines Lebens», sagt sie heute.
Grundsätzlich lassen sich Angststörungen gut behandeln. Die Verhaltenstherapie ist dann erste Wahl. «In einer von uns durchgeführten Follow-Up Studie hat sich gezeigt, dass auch zehn Jahre nach einer Verhaltenstherapie die Rückfallquote gering ist», so Beesdo-Baum. In der Verhaltenstherapie lernen Betroffene Strategien, um mit ihren Ängsten umzugehen.
Jennifer Bauer begibt sich nach ihrem Klinikaufenthalt in psychotherapeutische Behandlung. Noch immer hat sie Schwierigkeiten ihre Angststörung anzunehmen und offen über ihre Ängste zu sprechen. Sie fühlt sich minderwertig – psychisch krank zu sein, ist nach wie vor ein Stigma. Dennoch: Das Bewusstsein mit der Erkrankung nicht alleine zu sein, gibt ihr Kraft. «Ich versuche die Krankheit nicht mehr zu verdrängen und mir zu sagen, es ist eine Krankheit wie jede andere, so wie manch anderer Diabetes hat».
Fotocredits: Monique Wüstenhagen
(dpa/tmn)